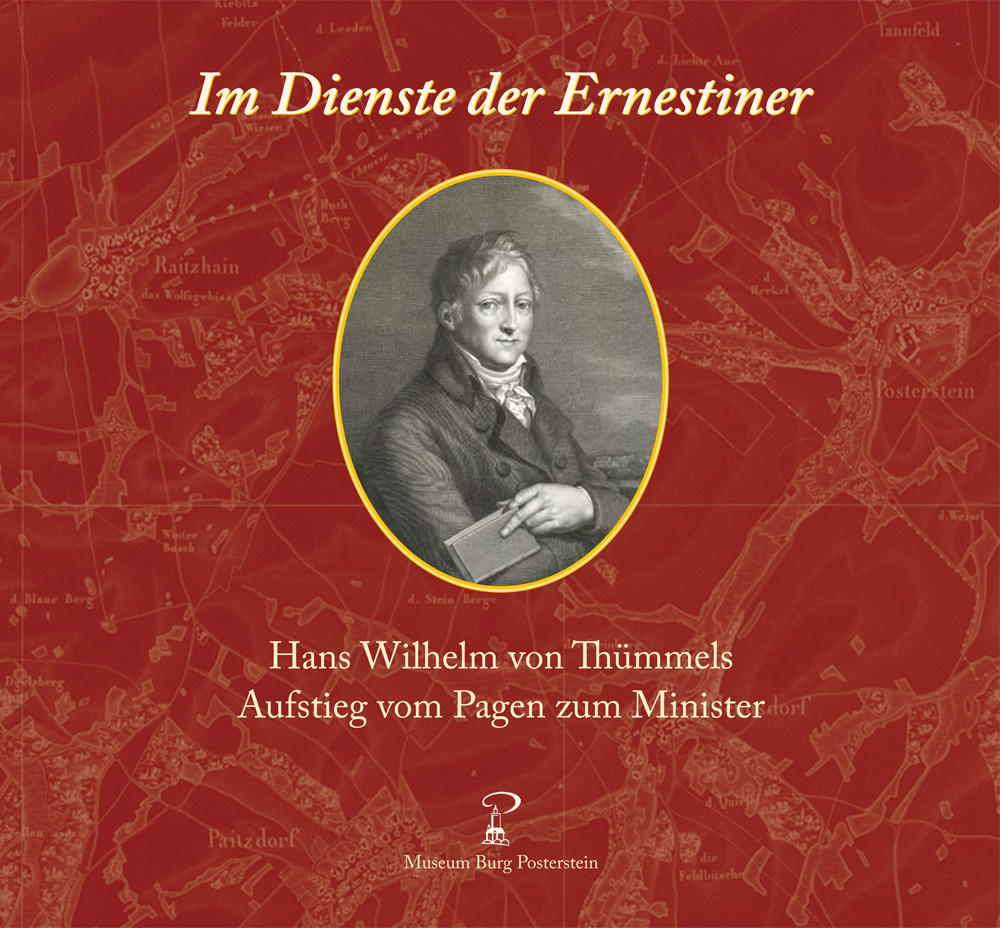Aktualisierte Informationen zu den Postersteiner Bauernportraits gibt es hier.
Den 37. Internationale Museumstag nutzte das Museum Burg Posterstein um drei neu erhaltene Exponate aus der regionalgeschichtlichen Sammlung näher vorzustellen: Die Pastell-Portraits einer Altenbruger Bauernfamilie. Der Bauernmaler Friedrich Mascher porträtierte die “Malscher und Marschen” in ihrer ortstypischen Tracht. Dieser Blogpost gibt Einblicke in die Kultur der Bauern im Altenburger Land.

Altenburger Bauerntrachten (historische Postkarte aus der Sammlung des Museums)
Ein der Teil der Sammlungen des Museums ist der eigenständigen Kultur der Altenburger Bauern gewidmet, die sowohl in der Bauart der Höfe, als auch einer eigenen Mundart, Tracht sowie speziellen Traditionen wie Hochzeitszeremonie und Bauernreiten (Hochzeitszug) oder einer ausgeprägten Gasthofkultur sichtbar wird.
Blütezeit der Gasthöfe
Auf Grund der hervorragenden Wirtschaftlichkeit der Höfe, die wesentlich auf den fruchtbaren Boden und einem speziellen Erbrecht (Unteilbarkeit der Höfe, der jüngste Sohn erbte) basierte, verfügten die Bauern auch über Freizeit. Manche nutzte diese seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zur Beschäftigung mit Naturkunde und Geschichte.

Altenburger Bauern – im Hintergrund das Residenzschloss Altenburg
Eine Blütezeit erlebten dadurch vor allem die Gasthöfe. Der Gasthof war Versammlungs- und Kommunikationsort. Nach erfolgreichen Geschäften an Marktagen in den Städten oder an Fest- und Feiertagen kehrte man standesgemäß ein. Bedeutsam sind die Gasthöfe nicht nur als gesellige Zentren der Ortschaften, sondern auch wegen ihrer einzigartigen, architektonisch interessanten Festsäle. Große Säle mit über 2000 Plätzen, Bühnenbauten und umlaufenden Galerien, wechselten sich mit kleineren Sälen ab, je nach Wohlstand der Region und ihrer Besitzer.
Heute bezeugen nur noch wenige bewirtschaftete alte Gasthöfe diese Zeit, ein Großteil von ihnen ist aufgegeben, verfallen, abgerissen oder zu Wohnzwecken umgebaut. Die Trachten der Altenburger Bauern sind aus dem Alltag gänzlich verschwunden. Eine Renaissance erleben diese aber in jüngster Zeit durch Trachtenträger zu Folklorefesten und in der Brauchtumspflege.
Bäuerliche Trachten im Altenburger Land
Die Träger der Altenburger Bauerntracht wurden auch als Marche – was sich wohl von Marie ableitet – und als Malcher (Melchior) bezeichnet. Die Tracht war zumeist teuer ausgearbeitet und steht somit als Symbol für den Wohlstand der Region. In Pierers Universallexikon von 1840 ist folgendes über die Trachten und Sitten der Altenburger Bauern nachzulesen:
Die Tracht des Bauern
… „Sie tragen sehr weite, kurze Hosen von schwarzem, sämischgarem Leder, einen schwarzen Latz ohne Aermel, den Hosenträger über demselben, einen schwarzen Rock (Kappe) ohne Kragen (statt derselben ragt der Hemdkragen hervor) mit grünem Futter und nur selten (sonst häufiger) einen weißen tuchnen Rock. Oft tragen sie gar keinen Rock, sondern gehen in bauschigen Hemdärmeln, oder haben statt desselben einen kurzen Tuchspenser; außerdem haben sie enge, bis an das Knie reichende Stiefeln und einen kleinen, runden Hut mit niedrigem Kopf und schmaler, vorn senkrechter, hinten aufwärts stehender Krämpe. Im Winter haben sie Lederpelze und Kragenmäntel.“…
Die Tracht der Bäuerin
… „Die weit unkleidsamere Tracht … zeichnet sich durch den enggefälteten, nur wenig über die Knie reichenden , prallen und ausgepolsterten Rock von buntem Kattun, und durch den pappenen, die Brust völlig breit drückenden Latz aus. Außerdem tragen sie Schürzen, ein enganliegendes Corset und eine hinten weit übergebogene Mütze mit buntem oder schwarzem Band. Im Sommer und bei Festen tragen sie Strümpfe und Schuhe oder Klapppantoffeln , im Winter Halbstiefeln, einen Tuchspenser und einen Tuchmantel mit langem Kragen. Bei Hochzeiten, Gevatterschaften und sonstigen Festlichkeiten tragen die Mädchen (deren gewöhnliche Mützen hinten zulaufen, während die der verheirateten Frauen einen kleinen, gefälteten Kranz bilden ), Hormte, pappene Mützen, mit Band umwunden oder mit rotem Sammet überzogen, oben offen, mit beweglichen Goldblättchen behangen.“ …
Das Hormt – der Festtagsschmuck

Die Marche und der Malcher in ihrer traditionellen Altenburger Tracht
Mundartlich abgewandelt, stammt der Begriff aus dem Mittelhochdeutschen und steht für Harband (auch habant), das Haarband. Das Hormt hat seinen Ursprung in der altgermanischen Kopfbinde, eines aus Wolle, Leinen oder Metall hergestellten Kopfschmucks. Es wurde von den Familien wohlhabender Bauern als wertvoller Besitz, als so genanntes „Mutterteil“ weitervererbt.
Tragen durften es die Mädchen von der Konfirmation bis zur Verheiratung. Schwangeren und solchen, die unehelich geboren hatten, sowie verheirateten Frauen war das Tragen des Hormtes verboten. Es war also Zeichen der Jungfernschaft. Man nannte die Hormtträgerinnen deshalb auch Hormtjungfern, die bei der Kommunion das Recht hatten, in ihrem Ehrenschmuck zuerst an den Altar zu treten und das Abendmahl zu empfangen. Festlichster Anlass für das Tragen des Hormtes war dann die Hochzeit nach althergebrachten Brauch.
Portrait einer Altenburger Familie um 1860

Mascher-Portrait des Bauern Pfrenger Schellenberg aus Greipzig um 1860 (Museum Burg Posterstein)
Neben den Trachten selbst spielen auch ihre Darstellungen auf Grafiken, Ansichtskarten und Gemälden eine zentrale Rolle für die kulturgeschichtliche Sammlung des Museums Burg Posterstein. Als Ankauf gelangten drei Portraits in den Besitz des Museums, welche ursprünglich aus dem Besitz der Familie Pfrenger aus dem Ort Greipzig stammen. Die Werke entstanden um 1860 und wurden vom bekannten Bauernmaler Ernst Friedrich Mascher gemalt. Als Brustbild vor blauem Himmel wurde das Ehepaar (Schellenberg, wie sich später herausstellte) in Pastell gezeichnet und trägt dabei die Altenburger Bauerntracht, vom Künstler im Detail herausgearbeitet. Somit stellen die Gemälde einen ganz speziellen Bezug zur Kultur des Altenburger Landes, zu seinen Bewohnern und dem Künstler dar, der die Arbeiten anfertigte. Nach einer grundsätzlichen Restaurierung erhielten die Werke nun einen Platz in der ständigen Ausstellung.
Der wandernde Künstler Ernst Friedrich Mascher
Die Familie Pfrenger Schellenberg war nicht die einzige aus der Umgebung Altenburgs, die sich vom wandernden Künstler Friedrich Mascher porträtieren ließ. Tatsächlich gab es wohl kaum ein größeres Bauerngut, das kein Werk des Künstlers besaß. Die meisten seiner Bilder sind aus dem Wieratal bekannt, besonders aus Frohnsdorf. Doch auch in und um Gößnitz, Dobitschen, Meucha und an der Westgrenze des Kreises war Mascher tätig. Wieviele Bilder er tatsächlich anfertigte ist nicht nachzuvollziehen, doch schenkt man der Beschwerde des Altenburger Malers Franz Richter von 1860 Glauben, so stellte Mascher in einigen Dörfern 20-30 Bilder her. In anderen Orten sogar mehr. Er war ein sehr bekannter Mann. Am 18. Juli 1880 erschien ein Nachruf auf seinen Tod in der größten Tageszeitung der Residenzstadt Altenburg: in der „Altenburger Zeitung für Stadt und Land“. Dabei hatte Mascher nicht einmal einen Wohnsitz in Altenburg; kam noch nicht einmal aus der Region!
Doch trotz seiner Bekanntheit sind kaum Fakten über sein Leben bekannt. Was wir wissen ist, dass Ernst Friedrich Mascher am 6. November 1815 in Tennstedt geboren wurde. Er war das dritte Kind von Heinrich Christian Maschers (Wagner oder Stellmacher von Beruf) und dessen Frau Charlotte Friederike. 1842 heiratete Friedrich Mascher eine Frau aus dem Anhaltinischen: Sophie Friedrike Leopoldine Rosamunde Riede, mit welcher er 1853 einen Sohn, Friedrich Hugo, bekam. Die Familie lässt sich in den Adressbüchern von Weißenfels und Halle fassen, aber nie im Altenburgischen. Mascher ging hier nur seiner Tätigkeit nach. Bei seiner Hochzeit gab er sogar an, er sei von Berufswegen „Mahler in Altenburg“.
Ein rätselhafter Tod
Seit Anfang der 1870er Jahre lebte der Künstler aber wohl von seiner Familie getrennt, führte scheinbar ein Wanderleben und wird von Zeugen als stiller, untersetzter Mann beschrieben.
So rätselhaft wie sein Leben, waren schließlich auch die Umstände seines Todes: Am 26. Juni 1880 wurde er im Luckaer Forst besinnungslos aufgefunden und ins Landeskrankenhaus nach Altenburg gebracht, wo er am 29. Juni 1880, wohl an einer Lungenentzündung, starb. Wie es zu diesem Ende kam, ist nicht geklärt. Nach Angaben der Ärzte erwachte Mascher nicht mehr aus seiner Ohnmacht. War er das Opfer eines Raubes geworden? Oder ein Opfer seiner Wanderschaft? Diese Fragen müssen wohl ungeklärt bleiben.
Maschers Werk: Hohe Portraitähnlichkeit, durchwachsene künstlerische Qualität

Von Maschner portraitierte Bauersfrau Pfrenger Schellenberg aus Greipzig (Museum Burg Posterstein)
Friedrich Mascher malte sicherlich nicht nur für ein bäuerliches Klientel. Wenigstens ein Bild von ihm ist auch aus bürgerlichem Haushalt bekannt. Je nach Auftragslage werden es wohl einige mehr gewesen sein. Ausführlich dokumentiert sind allerdings nur die Bauernportraits aus dem Altenburger Land.
Mascher wird eine hohe Portraitähnlichkeit angerechnet, sein Werk gilt allerdings als von durchwachsener künstlerischer Qualität. Einige Bilder sind aufs Feinste ausgearbeitet, andere eher grob gefertigt. Die Unterschiede sind so gravierend, dass einige Zeit lang in der Forschung angenommen wurden, es gäbe zwei Maler „Friedrich Mascher“. Vater und Sohn vielleicht? Doch diese qualitativen Unterschiede scheinen eher mit einer gewissen Routine beim Malen, einer Anpassung an moderne Auffassungen oder reiner Flüchtigkeit zusammen zu hängen.
In der Regel malte Mascher seine Modelle vor blauem Himmel und in reich verzierter Tracht. Besonders bei der Kleidung legte der Künstler sein ganzes Talent an den Tag. Selbst die verschiedenen Stoffe der Tracht lassen sich auf den Bildern ausmachen. Die Gesichter der Marschen sind zumeist freundlich. Die Damen sind oft mit einem Blumenstrauß bzw. mit einer Riechblume dargestellt und haben reich beringte Hände. Die Männer sind meist mit einer brennenden Zigarre und – wohl je nach Sympathie des Malers – freundlich dargestellt. Mascher malte stets Pastelle und trug die Farbe auf Tapete oder ähnliches Papier auf.
Vater, Mutter, Kind – Die Bilder im Museum Burg Posterstein
Zwei der drei Bilder, welche das Museum für die Sammlung gewinnen konnte, lassen sich Friedrich Mascher zuordnen. Dabei handelt es sich um das bereits genannte Ehepaar Pfrenger Schellenberg. Sie sind im typischen Stil des Malers – in Pastell – gefertigt und auf dem Portrait des Hausherren lässt sich die Signatur Maschers und das Datum 1860 nachweisen. Die beiden Werke passen äußerlich gut zusammen: Beide vor blauem Himmel gemalt, die Frau mit zwei Blumen in der Hand und reich beringten Fingern, der Mann mit Hund dargestellt. Beide Portraits sind auf alter Tapete aus der entsprechenden Zeit aufgebracht.
Ein ebenfalls neu erworbenes Kinderportrait gibt allerdings Rätsel auf. Eine Signatur ist nicht auszumachen, die Technik scheint eine andere zu sein, Fehlstellen wurden bereits ausgebessert und auch der Hintergrund und die allgemeine Erscheinung wollen nicht recht zu den beiden anderen Werken passen. Ob es sich bei diesem letzten Stück um ein weiteres Bild Maschers handelt, kann nur schwer bestimmt werden. Vielleicht stammt es auch aus einer anderen Zeit und sollte die Familie nachträglich komplettieren.
Nach umfassender Restaurierung (u.a. Entfernung der Pappe beim Kinderbild, neue Ergänzung der Fehlstellen, Schaffung einer luftdichten Rahmung) konnten die Bilder pünktlich zum internationalen Museumstag am 18. Mai 2014 in neuem Glanz präsentiert werden. Unter Rücksichtnahme auf die Empfindlichkeit der Arbeiten haben sie nun zeitweise ihren Platz in der ständigen Ausstellung des Museums gefunden.
Zum Weiterlesen:
Ingo Bach: Neues zu dem Leben von Ernst Friedrich Mascher; Sächsische Heimatblätter, Sonderdruck aus dem Heft 5/68, 1968, S. 214-216.
Aufsatz von Gustav Wolf: Der Bauernmaler Friedrich Mascher, in: Die Altenburger Bauern im Kunsthandwerk und in der bildenden Kunst. Begleitheft zur Sonderausstellung im Schloss- und Spielkartenmuseum Altenburg, Altenburg 2012.
Von Franziska Engemann